15. August 2025
Revidierte GCP-Leitlinie ICH E6(R3)
Risikobasiert, praxisnah, zukunftsorientiert: Die wichtigsten Änderungen in der Good Clinical Practice Leitlinie
Seit dem 15. August 2025 gilt auch in der Schweiz die revidierte Good Clinical Practice-Leitlinie, ICH E6(R3). Mit ihrer Einführung zu Beginn des Jahres trägt der International Council of Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) der zunehmenden Komplexität klinischer Studien Rechnung. Ziel ist es, auch unter veränderten Rahmenbedingungen Effizienz, wissenschaftliche Qualität und vor allem den Schutz der Studienteilnehmenden in der klinischen Forschung nachhaltig zu gewährleisten.
Von 13 auf 11, aber umfangreicher: Was sich an den GCP-Grundprinzipien ändert
Mit E6(R3) wurde die GCP-Leitlinie neu strukturiert: Die aktualisierte Version enthält nicht mehr 13, sondern 11 Grundprinzipien. Diese sind dafür mit Unterpunkten detaillierter und praxisnah ausformuliert. Zwei Grundprinzipien wurden neu eingeführt: Das Prinzip der Risikoproportionalität («Risk proportionality») sowie das Prinzip der Rollen und Verantwortlichkeiten («Responsibilities»). Ersteres legt fest, dass Studienprozesse sich am tatsächlichen Risiko und an der Komplexität des jeweiligen Studiendesigns orientieren sollen. Für Studienteams bedeutet dies in der Praxis, nicht zusätzliche Massnahmen umzusetzen, sondern der Zweckmässigkeit Vorrang zu geben und sich zu fragen: Was ist in dieser spezifischen Studie absolut entscheidend für die Sicherheit der Studienteilnehmenden und für die Datenqualität?
Mit dem Prinzip der Verantwortlichkeiten konkretisiert die E6(R3) die Rollen- und Verantwortungsverteilung, insbesondere für den Sponsor. Dazu gehören die Anforderungen an Delegation, Überwachung und Qualitätssicherung. Auch hier sollen praxisorientierte Lösungsansätze gefördert werden, die sowohl den regulatorischen Anforderungen als auch der operativen Realität gerecht werden.
Quality by Design als Leitgedanke
Die E6(R3) bekräftigt ausdrücklich das in der ICH E8(R1)-Leitlinie eingeführte Quality by Design (QbD)-Konzept und übersetzt sie in konkrete Anforderungen für Sponsor sowie Investigator. QbD bedeutet, Qualitätsaspekte von Beginn weg in das Studienprotokoll und die Prozesse zu integrieren, anstatt sie später zusätzlich einzufügen. Qualität ist dabei nicht mit dem Abarbeiten von Compliance-Checklisten gleichzusetzen. Vielmehr ist sie als «Mindset» zu verstehen, bei dem das Studienteam kontinuierlich und proaktiv den Schutz der Studienteilnehmenden und die Integrität der Daten priorisiert. Hierfür werden frühzeitig kritische Qualitätsfaktoren (Critical to Quality) identifiziert, wie etwa die Messung des primären Endpunkts oder wichtige Sicherheitsbewertungen, und durch risikoadäquate Massnahmen angegangen.
Möchten Sie Ihr Wissen auffrischen?
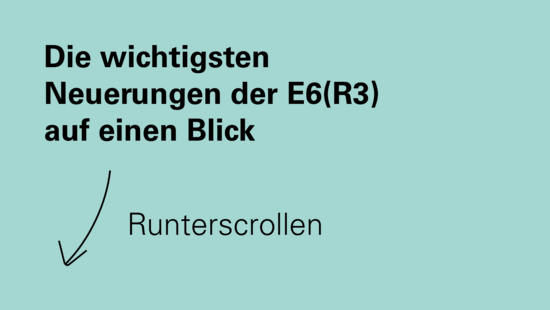
Was bedeutet die R3 für Forschende?
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die revidierte GCP-Leitlinie eine zweckmässige, risikobasierte und proaktive Planung und Durchführung klinischer Studien klar in den Mittelpunkt rückt (siehe auch Tabelle). Sie erkennt an, dass individuelle Studien massgeschneiderte Lösungen brauchen. Zugleich gewinnen Aspekte wie Patientenbeteiligung, Transparenz und die Integration dezentraler sowie digitaler Verfahren deutlich an Bedeutung. Für Studienärztinnen und Studienärzte bedeutet dies mehr Eigenverantwortung, aber auch Handlungsspielraum und grössere Flexibilität.
Die wichtigsten Neuerungen der E6(R3) auf einen Blick
Gliederung | Neuorganisation in 11 Prinzipien, Annex 1 mit Erläuterungen zu interventionellen klinischen Studien, Glossar und Appendizes sowie Annex 2 zu nicht-traditionellen interventionellen klinischen Studien. Annex 2 tritt frühestens 2026 in Kraft. |
Quality by Design (QbD) und Risikoproportionalität | Qualität im Sinne von QbD geht über das reine Erfüllen von Compliance-Checklisten hinaus. Sie beschreibt eine Haltung, bei der das Studienteam bereits in der Planungsphase konsequent den Schutz der Teilnehmenden und die Datenintegrität in den Vordergrund stellt. Dabei erkennt ICH E6(R3) an, dass Studien unterschiedlich sind und sich die Qualitätsbemühungen auf die wichtigsten Risiken konzentrieren sollten – ein Prinzip der Risikoproportionalität. Entsprechende Qualitätsaspekte werden von Beginn an proaktiv in Protokoll und Entwicklungspläne integriert, anstatt nachträglich ergänzt zu werden. |
Data Governance | Ein neu geschaffenes, eigenständiges Kapitel behandelt die Datenintegrität und Rückverfolgbarkeit über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg: von der Erhebung über Audit Trails bis zur Archivierung und Löschung. Gefordert wird eine kontinuierliche Validierung computerisierter Systeme, eine strikte Benutzer- und Rollenverwaltung sowie Massnahmen zur Sicherstellung der Verblindung. |
Studiendesigns und technologischer Fortschritt | Innovative Studiendesigns wie adaptive Studien, Plattform-Studien, dezentrale Elemente etc. sowie technologische Neuerungen werden berücksichtigt. So werden bspw. der Einsatz der elektronischen Einwilligungserklärung (eConsent) sowie des Remote Monitoring ausdrücklich unterstützt. |
Rollen und Verantwortlichkeiten | Die Pflichten von Sponsor, Investigator sowie beauftragten Dienstleistern werden detaillierter beschrieben und klar voneinander abgegrenzt. Grundsätzlich gilt: Delegation ist zulässig, die Gesamtverantwortung verbleibt bei der delegierenden Person. |
Patientenorientierung | Gefordert wird eine stärkere Patientenorientierung durch reduzierte Belastung, Berücksichtigung unterrepräsentierter Gruppen und Offenheit für dezentrale sowie adaptive Studiendesigns. |
Transparenz | Die Forderung nach Transparenz und Nachvollziehbarkeit im gesamten Studienprozess wird betont. Dies umfasst nicht nur die Verpflichtung zur Studienregistrierung, die Berichterstattung über Ergebnisse und die Offenlegung relevanter Studiendaten, sondern auch transparente und zeitgerechte Kommunikation mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Studienteilnehmenden in laienverständlicher Sprache. |
Glossar | Ein umfangreiches Glossar enthält überarbeitete Begriffe wie zum Beispiel «trial participant» anstatt «subject» sowie neue Definitionen zu Datenquellen, Dokumenten und Systemvalidierung. |

